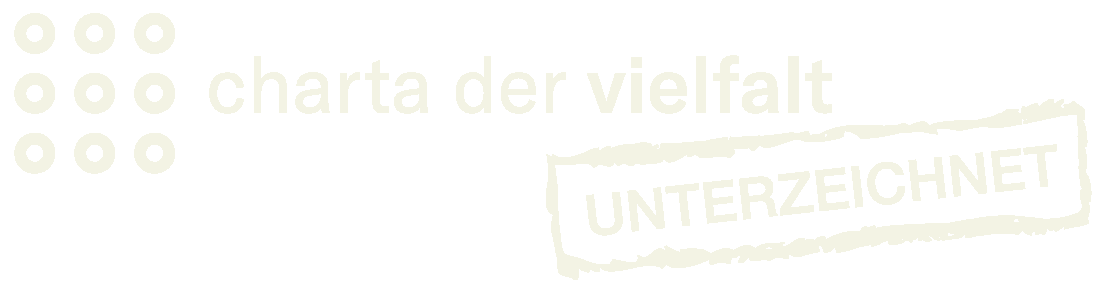„Um Hindernisse für eine ambitionierte Klimapolitik zu überwinden, kann die Ausarbeitung kurzfristiger Maßnahmen dazu beitragen, langfristige Ziele zu erreichen“, sagt Michael Pahle vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), Hauptautor der von der Stiftung Mercator finanzierten und nun in Nature Climate Change veröffentlichten Studie. „Ein Blick auf den Erfolg der Vorreiter in der Klimapolitik zeigt, dass zunehmend ehrgeizige Maßnahmen und Ziele durch vorangegangene kurzfristige Maßnahmen ermöglicht wurden, die diese Hindernisse verringert oder abgebaut haben. Dies ist jedoch keineswegs automatisch der Fall, sondern hängt davon ab, dass Maßnahmen als mehrstufige Abläufe betrachtet und entsprechend konzipiert werden.“
In der Studie werden verschiedene Beispiele untersucht, die einige überraschende Ähnlichkeiten zwischen Deutschland und Kalifornien aufzeigen. Eine davon ist die frühzeitige Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung erneuerbarer Energien, die im Laufe der Zeit eine Wählerschaft hervorbrachte, die immer ehrgeizigere politische Ziele unterstützte. „Anfangs schien dies nicht besonders bedeutend zu sein – aber es trug dazu bei, Interessengruppen zu bilden, die sich zu einer Lobby für erneuerbare Energien und Klimapolitik im weiteren Sinne entwickelten und damit nicht nur das Energiesystem, sondern auch die politische Landschaft um dieses herum veränderten“, erklärt Co-Autor Dallas Burtraw vom US-Thinktank Resources for the Future (RFF). Ein ähnliches Beispiel ist das California Air Resources Board. „Nach seiner Gründung in den 60er Jahren erlangte es im folgenden Jahrzehnt beträchtliche Fachkompetenz und Vertrauen im Bereich Luftqualitätsmanagement, was für die Umsetzung des Cap-and-Trade-Programms von entscheidender Bedeutung war“, sagt Burtraw.
Sequenzierung zur Verschärfung der Klimapolitik
Christian Flachsland, Mitautor und Gruppenleiter am Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC), betont, wie wichtig es ist, bei der Betrachtung langfristiger Dekarbonisierungswege Pfadabhängigkeiten und komplexe wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Dynamiken zu berücksichtigen. „Wir müssen langfristige integrierte Bewertungsmodelle durch Analysen politischer Rückkopplungsprozesse ergänzen, die sich in Zukunft entwickeln könnten. Ein besseres Verständnis der zeitlichen Politikdynamik, die wir in der Vergangenheit beobachtet haben, wird uns helfen, unsere Überlegungen zu diesen zukünftigen Pfaden zu verbessern.“
„Wir hoffen, zur Weiterentwicklung der Politikgestaltung beitragen und den Konflikt zwischen Befürwortern gegensätzlicher politischer Ansätze schlichten zu können, indem wir aufzeigen, wie der eine Ansatz zum anderen führen kann“, sagt Co-Autor Ottmar Edenhofer, Direktor des PIK und des Mercator Research Institute for Global Commons and Climate Change (MCC). „Die Umsetzung der Sequenzierung kann wertvolle Orientierungshilfen für die Erfüllung des Auftrags der von der Bundesregierung eingesetzten Kohlekommission liefern. Die Stilllegung von einigen Gigawatt Kohlekraftwerkskapazität durch regulatorische Maßnahmen in den nächsten Jahren sollte mit einer Erhöhung der CO2-Bepreisung im nächsten Jahrzehnt einhergehen, um sicherzustellen, dass die Regulierung eine echte und dauerhafte Wirkung auf die Gesamtemissionen hat. Aus Sicht der Sequenzierung sind Regulierung und Bepreisung keine Alternativen, sondern Ergänzungen, die kurzfristige und langfristige Maßnahmen miteinander verbinden.“
Artikel: Michael Pahle, Dallas Burtraw, Christian Flachsland, Nina Kelsey, Eric Biber, Jonas Meckling, Ottmar Edenhofer, John Zysman (2018): Sequencing to ratchet up climate policy stringency. Nature Climate Change. [DOI: 10.1038/s41558-018-0287-6]
Weblink to the article: https://www.nature.com/articles/s41558-018-0287-6