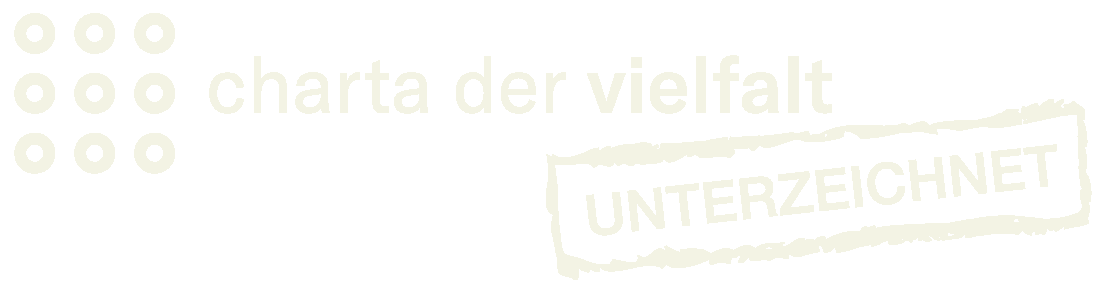Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens von 2015 zu erreichen, ist eine tiefgreifende und rasche Reduzierung der Treibhausgasemissionen erforderlich. Nachdem 2024 die Regeln für den internationalen Handel mit Emissionszertifikaten festgelegt wurden, steigt die Nachfrage nach CO₂-Kompensationen deutlich. Doch den Autorinnen und Autoren zufolge sind diese Kompensationen – handelbare Gutschriften aus Projekten, die erklärtermaßen Emissionen reduzieren oder entfernen – oft weder echt noch zusätzlich oder dauerhaft. Sie argumentieren deshalb, Kompensationen dieser Art aus nationalen CO₂-Bepreisungssystemen auszuschließen, so wie es die Europäische Union im Jahr 2020 mit ihrem Emissionshandelssystem (EU-ETS) getan hat.
Derzeit erlauben rund 40 Prozent der existierenden CO₂-Bepreisungssysteme die Nutzung von Kompensationen – meist ohne wirksame Qualitätskontrollen oder Mengenbeschränkungen. Eine aktuelle Analyse zeigt, dass von über 2300 untersuchten Kompensationsprojekten nur knapp 16 Prozent die versprochenen Emissionsminderungen erreicht haben.
Fehlt es den Kompensationen an Glaubwürdigkeit, spiegeln die Preise für Emissionszertifikate nicht die Kosten echter Emissionsminderungen wider, sondern lediglich die Kosten von „Scheinreduktionen“. Die Folge sind künstlich niedrige CO₂-Preise, die den Anreiz verringern, Emissionen zu senken. Gleichzeitig drängen diese niedrigen Preise hochwertige Projekte vom Markt. Aktuell unterliegen zwar rund 28 Prozent der globalen Emissionen einer CO₂-Bepreisung – doch nur 3,2 Prozent werden mit mehr als 60 Dollar pro Tonne besteuert. Studien zufolge ist dies jedoch die Mindestsumme, um die Erderwärmung auf deutlich unter 2 °C zu begrenzen.
Kompensationen schwächen CO₂-Bepreisungssysteme
Die mangelnde Wirksamkeit von Kompensationen geht laut den Autorinnen und Autoren auf strukturelle Schwächen zurück. So müssten Kompensationen zusätzlich sein, das heißt sie dürfen nur Projekte finanzieren, die ohne sie nicht umgesetzt würden. Doch der Nachweis tatsächlicher Emissionsminderungen ist schwierig, da diese meist mit hypothetischen „Business-as-usual“-Szenarien verglichen werden, die von den Projektentwicklern selbst erstellt werden. Das führt zu überhöhten Ausgangswerten, die den Anschein von Emissionsreduktionen erwecken.
Zudem bestehen Informationsasymmetrien: Nur die Projektverantwortlichen wissen, ob ihre Projekte wirklich auf Einnahmen aus dem Zertifikateverkauf angewiesen sind oder ob sie ohnehin umgesetzt worden wären. Ein weiteres Problem ist die meist fehlende Dauerhaftigkeit: Viele Kompensationen garantieren die Speicherung von CO₂ nur für wenige Jahrzehnte, während Treibhausgase Hunderte bis Tausende von Jahren in der Atmosphäre verbleiben können. Falsche Anreize führen außerdem dazu, dass Käufer zu den billigsten Zertifikaten greifen und Regierungen wiederum eher auf hohe Verfügbarkeit achten statt auf die ökologische Integrität der Projekte.
Empfehlungen für die Politik
Neben dem Ausstieg aus Kompensationen in nationalen Emissionsmärkten empfiehlt das Forschungsteam, Kompensationen aus den nationalen CO₂-Märkten auszuschließen und Preisobergrenzen für Emissionen einzuführen, die sich über die Zeit verschärfen. Es plädiert dafür, dass Emittenten, die ihre Verpflichtungen nicht erfüllen, Zahlungen an den Staat leisten müssen.
Wenn überhaupt, sollten CO₂-Kompensationen nur bei schwer vermeidbaren Emissionen genutzte werden. Und ausschließlich in Verbindung mit Technologien, die CO₂ langfristig (über Jahrhunderte bis Jahrtausende) aus der Atmosphäre entfernen. Zudem sollten sie nur in Systemen verwendet werden, die mit den Zielen des Pariser Abkommens kompatible CO₂-Preise und nahe Null liegende Emissionsgrenzen aufweisen, schreiben die Autorinnen und Autoren.
Kommentar:
Macintosh A., Trencher, G., Probst, B., Barley, S., Cullenward, D., West, T. A. P., Butler, D. & Rockström, J. (2025): Carbon credits are failing to help with climate change - here’s why. Nature, 646 (8085). [DOI: 10.1038/d41586-025-03313-z]
Weblink zum Kommentar:
Kontakt:
PIK-Pressestelle
Telefon: +49 (0)331 288 2507
E-Mail: press@pik-potsdam.de
Web: https://www.pik-potsdam.de/de
Social Media: https://www.pik-potsdam.de/social