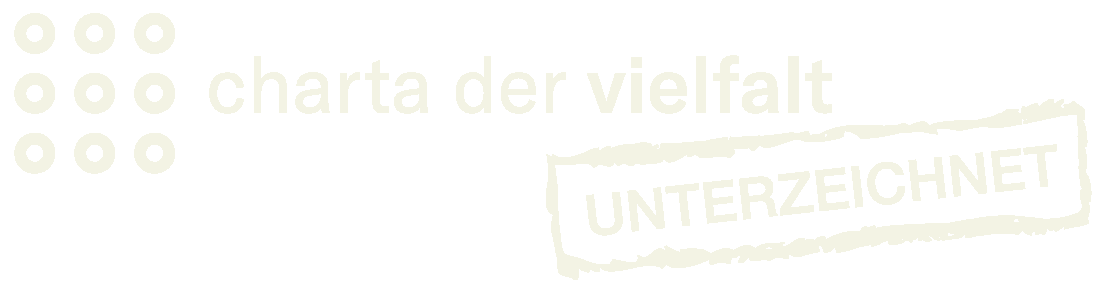„Die Schäden des Klimawandels und die Kosten von Klimapolitik betreffen Arme und Reiche unterschiedlich, sowohl international als auch national“, sagt Simon Feindt, PIK-Forscher und Co-Autor der Studie. „Wenn die Lasten überproportional auf die Ärmeren fallen, kann das die Unterstützung für Klimapolitik verringern, und das gilt es zu vermeiden: Die CO₂-Bepreisung generiert ja Mittel, welche für die Entlastung der Ärmsten genutzt werden können.“ Wie Klimapolitik auf das Arm-Reich-Gefälle auf Länderebene wirkt, wird in den globalen Rechenmodellen zur wissenschaftlichen Politik-Evaluation bislang wenig beleuchtet. „Hier schafft unsere Arbeit neue prinzipielle Einblicke“, so Feindt. „Sie zeigt, wie Klima- und Sozialpolitik Hand in Hand gehen können.“
Für die Analyse entwickelte das Forschungsteam ein neuartiges Integriertes Bewertungsmodell, welches die Zusammenhänge zwischen Wirtschaft, Einkommensverteilung und Klimapolitik in 179 Ländern abbildet, und rechnete verschiedene Varianten eines Szenarios durch: Die Politik bekämpft weltweit mittels CO₂-Bepreisung die Erderhitzung und verteilt die Einnahmen an die Bevölkerung zurück. Dieses Vorgehen verändert auf dreifache Weise die Einkommen: Erstens verteuert die Politik damit fossile Energie; zweitens verteilt sie ja CO₂-Preis-Einnahmen zurück; und drittens verringert sie im Ergebnis die Klimaschäden. Um diese Schäden zu beziffern, stützt sich das Forschungsteam auf eine PIK-Studie von 2020.
Blick auf die ärmere Hälfte der Bevölkerung
Die Szenario-Varianten unterscheiden sich dadurch, ob der CO₂-Preis global einheitlich oder nach Ländern differenziert ist, also wie stark sich fossile Energie verteuert, sowie in der Art der Rückverteilung der Einnahmen, also wie Haushalte davon profitieren. In allen Varianten zeigt sich: Eine CO₂-Bepreisung, die die Erderhitzung auf maximal 2 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau begrenzt, verbessert die Wohlfahrt gegenüber einem Business-as-usual-Szenario ohne zusätzliche klimapolitische Maßnahmen, bei dem sich die Erde im Jahr 2100 um 2,9 Grad erwärmt. Für diese Bewertung betrachtet das Forschungsteam ein bereinigtes Pro-Kopf-Einkommen, mit einem Abschlag je nach Höhe der ökonomischen Ungleichheit.
Der so definierte Wohlfahrtsgewinn wäre laut der Studie am größten in einer recht unrealistischen Variante: Die Welt einigt sich auf einen global einheitlichen CO₂-Preispfad, und auch die Rückverteilung der Einnahmen erfolgt über global einheitliche Beträge pro Kopf. Die Menschen in den ärmsten Ländern schneiden dabei vergleichsweise günstig ab – sie verursachen weniger CO₂ als die Menschen in den reichsten Ländern, zahlen also weniger für die CO₂-Bepreisung, bekommen aber genauso viel Geld aus der Rückerstattung der Einnahmen. Allerdings zeigt die Analyse: In diesem Fall würde die jeweils ärmere Hälfte der Bevölkerung in den reichsten Ländern im Durchschnitt Einkommen verlieren. Zudem müsste enorm viel Geld in den globalen Süden fließen, was schwer durchsetzbar erscheint.
Das Akzeptanzproblem entschärfen
Vorteilhafter erscheint deshalb eine andere Variante, in der in allen Ländern der Welt die jeweils ärmere Bevölkerungshälfte Einkommen dazugewinnt. Auch hier gibt es einen global einheitlichen CO₂-Preispfad – aber der Geldtransfer in die ärmsten Länder wird auf den Ausgleich der Klimaschäden („Loss and damage“) begrenzt. Der Rest der Einnahmen wird auf nationaler Ebene über einheitliche Pro-Kopf-Transfers zurückverteilt. Der Nord-Süd-Transfer beträgt dann 2030 rund 100 Milliarden Dollar und 2050 rund 500 Milliarden Dollar, das sind 5 beziehungsweise 15 Prozent der globalen CO₂-Preis-Einnahmen. Ökonomisch vertretbar wäre laut der Studie auch eine pragmatische Alternative: eine nach Ländern differenzierte CO₂-Bepreisung, gepaart mit Rückerstattung auf nationaler Ebene.
„Seit dem Weltklimagipfel 2013 ist es Teil der internationalen Klimaverhandlungen, dass die reichen Länder – die den Klimawandel vor allem verursacht haben – über einen ,Loss-and-damage‘-Mechanismus für Schäden im globalen Süden zahlen“, erläutert die Studien-Leitautorin Marie Young-Brun (Institut für Wirtschaftsforschung Halle / Uni Leipzig). „Unsere Modellrechnung zeigt, dass dieser Mechanismus auch ein interessanter Orientierungspunkt für die Rückverteilung von CO₂-Preis-Einnahmen ist. Die ärmere Hälfte der Bevölkerung besser zu stellen, auch in den reichen Ländern, könnte das Akzeptanzproblem von Klimaschutz entschärfen.“
Artikel:
Young-Brun, M., Dennig, F., Errickson, F., Feindt, S., Méjean, A., Zuber, S., (2025): Within-country inequality and the shaping of a just global climate policy. – Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), Vol. 122, No. 39. [DOI: 10.1073/pnas.2505239122]
Weblink zum Artikel:
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2505239122
Kontakt:
PIK-Pressestelle
Telefon: +49 (0)331 288 2507
E-Mail: press@pik-potsdam.de
Web: https://www.pik-potsdam.de/de
Social Media: https://www.pik-potsdam.de/social